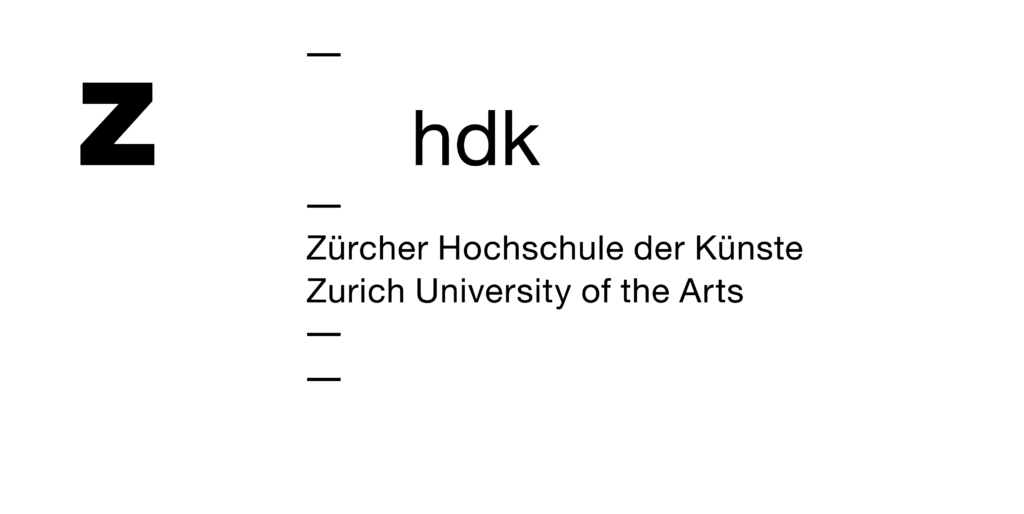Jenseits der zahlreichen biologischen Funktionen macht ihre Schönheit und bunte Vielfalt Blumen zu schmückendem Beiwerk in fast allen Lebenslagen; sie sind aber auch Trägerinnen von oft widersprüchlichen religiösen, politischen und magischen Bedeutungen, globaler Wirtschaftsfaktor und nicht zuletzt Inspiration und Vorlage für die Künste. Die Tagung nimmt alltagskulturelle Phänomene ebenso in den Blick wie politische Aspekte und gestalterische Positionen.
Programm
Donnerstag, 24. April 2025
10 bis 18 Uhr
Maison Shift, Zürich


10.00
Begrüssung
10.30
Anna-Brigitte Schlittler:
Die Floristin Constance Spry: «Doing the Flowers»
11.00
Katharina Tietze:
Künstliche Blumen als modische Accessoires
11.30
Isabela Gygax:
Die Sprache der Blumen in der Mode: Schönheit, Kunsthandwerk und Kritik
Mittagspause
13.30
Bitten Stetter:
Florale Normen: Ästhetik des Übergangs von Leben zu Tod
14.00
Francis Müller:
Blumen, Grenzen, Transzendenzen
14.30
Eva Wandeler:
Last Flowers
Videoinstallation und Gespräch
Kaffeepause
15.30
Franziska Nyffenegger:
Rose Rose Reseda: Ein Poesiealbum für Blumenfreund:innen
16.00
Erika Fankhauser Schürch:
Gibt es die eine einzige perfekte Blumenvase?
Kaffeepause
17.00
Ulrike Meyer Stump:
Von grossen und kleinen Blumen bei Karl Blossfeldt (1865-1932)
17.30
David Jäggi:
Von Tankstellenshop bis Grandhotel – eine fotografische Spurensuche
18 Uhr
Abschluss
Abstracts
Anna-Brigitte Schlittler
Die Floristin Constance Spry:
«Doing the Flowers»
Als am 2. Juni 1953 vor einem Millionenpublikum auf den Strassen Londons und weltweit vor den Fernsehgeräten Königin Elizabeth II gekrönt wurde, war dies wohl der Höhepunkt in Constance Sprys Karriere: Sie war beauftragt worden, die «processional route» vom Buckingham Palace zur Westminster Abbey mit Blumen zu schmücken. Doch der bereits mehr oder weniger zufällige Einstieg in die Floristik in den späten 1920er Jahren war für die damals schon über 40jährige Autodidaktin ein sensationeller Erfolg. Für die Eröffnung einer Parfümerie in Mayfair missachtete sie sämtliche Regeln der zeitgenössischen Floristik und dekorierte die Schaufenster mit üppigen Bouquets mit grossblumigen grünen Orchideen und «Unkraut», wie Hopfen, Brombeerranken und Waldrebe.
Mein Beitrag zeichnet den Weg von Constance Spry (1886–1960) nach und setzt dabei zwei Schwerpunkte: zum einen ihr bis heute einflussreiches florales Design, zum anderen die lesbische bzw. homosoziale Community, der sie in den 1930er Jahren angehörte. So liess sich Gluck von Spry – ihrer zeitweiligen Geliebten – zu eleganten Blumenstillleben inspirieren, die bis heute den Zauber der Spryschen Kreationen übermitteln.
Abschliessend werde ich ein Ereignis thematisieren, das Einblick gewährt in aktuelle Diskurse. 2004 geriet Constance Spry unversehens ins Zentrum eines öffentlich ausgetragenen Streits um eine retrospektive Ausstellung im Design Museum, bei dem es um weit mehr ging als um Floristik – nämlich um nichts weniger als um Deutungshoheiten und Definitionen von Design.
Katharina Tietze
Künstliche Blumen als modische Accessoires
Den menschlichen Körper mit künstlichen Blumen zu schmücken, hat eine lange Tradition. Prächtige Beispiele finden sich in der höfischen Mode des Rokokos. In der Folge entstanden an vielen Orten Blumenfabriken u.a. in Sebnitz in Sachsen aber auch in Weimar in Thüringen. Letztere wurde von Caroline Bertuch geleitet, dort war die spätere Ehefrau Goethes Christiane Vulpius beschäftigt. Der Ehemann Bertuchs gab ab 1787 das Journal des Luxus und der Modenheraus, in dem die neuesten Trends der Dekoration der Kleidung mit Kunstblumen beschrieben wurden. In der Frauenmode werden die Blumen, die zumeist aus Seidenstoffen hergestellt sind, sukzessive zum Ansteck- oder Hutschmuck. Sehr üppig fällt letzterer um 1900 aus, als die Hüte besonders gross und Dekorationen sehr vielfältig waren. In der Herrenmode überlebt die Knopflochblume, die Boutonnière. Ein berühmtes Beispiel ist die weisse Nelke, die Fred Astaire oft trug. In den 60er Jahren blühten die Blumen auf den Hüten. Ein Meister darin ist Cristobal Balenciaga: So wie die Blüte eine Pflanze schmückt, vollendete er ein Outfit mit der Kopfbedeckung. Heute finden sich die Kunstblumen nur noch vereinzelt, zum Beispiel als Kamelie bei Chanel oder in der Hochzeitsmode.
Fragen begleiten die Sichtung der verschiedenen Beispiele. Wann und warum wurde von natürlichen Blumen zu künstlichen gewechselt? Wie wurden die Blumen produziert? Wie botanisch präzise waren sie? Welche Abstraktionen gab es? Und nicht zuletzt welche Rolle spielten sie als Accessoires?
Isabela Gygax
Die Sprache der Blumen in der Mode: Schönheit, Kunsthandwerk und Kritik
Chanel, Dior, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent, Abraham, Lemarié, Indiennes sind Synonyme für renommierte Modehäuser, legendäre Designer:innen, Seidenhändler, Meisterateliers, Motive und kulturelles Erbe. Doch wer sich für die «Floriografie» der Mode interessiert, kann in diesen Namen einen Blumenstrauss aus Kamelien, Rosen, Orchideen, Mohnblumen, Nelken, Granatapfelblüten, Mangoblättern, Lotusblumen indische Flammenbaum-Blüten oder heiligem Basilikum entdecken.
In meinem Vortrag werde ich einerseits in die faszinierenden, blumigen Kreationen bekannter Designer:innen und Haute-Couture-Manufakturen wie das Atelier Lemarié eintauchen. Diese Kreationen sind oft nicht nur ästhetisch atemberaubend, sondern auch handwerklich verblüffende Meisterleistungen mit wichtigen kulturellen Konnotationen. Andererseits reflektiere ich kritisch das Blumen-Motiv und dessen Rolle in der westlichen Industrialisierung, Themen der Aneignung und Kolonialisierung und, im Zeichen des Fashion Revolution Days, die materielle Entstehung dieser textilen Kunstwerke. Dabei werde ich die unzähligen Hände der Sticker:innen, Färber:innen und Drucker:innen in den Blick nehmen, deren oft unsichtbare Arbeit in starkem Kontrast zur Opulenz der Kreationen steht. Diese Betrachtung eröffnet einen Dialog über die ethischen und sozialen Implikationen der Modeindustrie und regt dazu an, über die Verantwortung von Designer:innen und Konsument:innen nachzudenken.
Bitten Stetter
Florale Normen: Ästhetik des Übergangs von Leben zu Tod
Dieser Beitrag, basierend auf einer intensiven designethnographischen Forschung in Sterbesettings, untersucht, wie Blumen als Hybrid-Objekt für Leben und Vergänglichkeit im Sterbeprozess genutzt werden. Er beleuchtet die Rolle von Blumen in institutionellen Orten wie Palliativstationen und Hospizen. Blumen, als Symbol des Zyklus von Aufblühen und Verblühen, prägen die Atmosphären von Sterbesettings und Rituale rund um die Endlichkeit. Sie sind mehr als Dekoration: Sie materialisieren individuelle Spiritualität, fördern Trost und verbinden Menschen in einer gemeinsamen Erfahrung. Rituale mit Blumen – von Bouquets am Krankenbett bis zu Altarformationen – schaffen Raum für Transzendenz und Würde.
Blumen wirken dabei als Akteure im Sinne der Akteur-Netzwerk-Theorie (Latour), indem sie nicht nur Stimmungen beeinflussen, sondern auch Pflegehandlungen gestalten. Ihre Materialität – Duft, Farbe, Form – und ihre Platzierung erzeugen ästhetische „Bricolagen“ (Beck), die kulturellen Traditionen und individuelle Vorlieben vereinen.
Blumen unterliegen aber auch Normen, die durch gesellschaftliche und institutionelle Vorgaben bestimmt werden. Ihre Auswahl wird durch praktische Aspekte wie Duftempfindlichkeiten und hygienische Vorschriften beeinflusst. Das Fehlen von Blumen kann ebenso den Umgang mit dem Sterbeprozess und dem Tod verändern. Der Beitrag zeigt, wie Blumen als Symbole, Metaphern, Bildsujets den Zyklus von Aufblühen und Verblühen in den letzten Lebensphasen prägen – und welche Spannungen entstehen, wenn Rituale formalisiert werden und der symbolische Gehalt verloren geht. Vorgestellt werden zudem Gestaltungsvorschläge, die aus der Designforschung entsprungen sind
Francis Müller
Blumen, Grenzen, Transzendenzen
Blumen sind Natur – und zugleich Kultur. Blumen leben in der Natur, sie können profane Dekoration gestalteter Umgebungen sein oder elementare Symbole in Ritualen wie Geburt, Geburtstag, Diplomfeier, Hochzeit, Abdankung etc. Diese Blumen markieren Übergänge und Grenzen. Sie symbolisieren häufig Transzendentes, was sich deutlich in der Kunst, Religion, Literatur, Film etc. zeigt. Blumen können biologisch betrachtet werden, sie können ökonomische Produkte sein, sie können romantisch aufgeladen und mit einer Bedeutung des «Mystischen» versehen werden. Alle diese Perspektiven sind in bestimmten kulturellen und historischen Kontexten entstanden. Sie sagen mehr über die Gesellschaft aus als über die Blumen selbst, deren Essenz hinter den starken symbolischen Aufladungen verdunkelt bleibt. Was Blumen sind, hängt also von der Perspektive und vom Kontext ab, die sozial konstruiert, historisch, zeitlich und kulturell variabel sind. Blumen werden z. B. häufig geschenkt, womit sie in ökonomische, rituelle und emotionale Handlungsmuster verwoben sind: Bis zum Kauf sind sie Produkte mit Preisen. Ab dem Moment, in dem sie geschenkt werden, mutieren sie zu Symbolen der sozialen Beziehungen, die sich jeglicher ökonomischen Logik entziehen. So erhalten Blumen Bedeutungsüberschüsse: Blumen transzendieren das Hier und Jetzt und bleiben – nicht zuletzt aufgrund der Vergänglichkeit, die ihnen inhärent ist – zugleich doch darin befangen.
Eva Wandeler
Last Flowers
Videoinstallation und Gespräch
In einem Gespräch mit Katharina Tietze gibt Eva Wandeler Einblick in ihre künstlerische Praxis und die Entwicklung der Werkreihe «Last Flowers». Die Reihe setzt sich mit Vergänglichkeit, Transformation, stofflichen Kreisläufen und Konservierung auseinander. Letzte Blumensträusse aus der Palliativstation des Stadtspitals Waid wurden gesammelt, Schicht für Schicht in Wachs getaucht und die einzelnen Stadien des Transformationsprozesses filmisch festgehalten. Die Blumenarrangements verändern ihre Form und transformieren in körperhaft anmutende Wachsobjekte. Blumen werden oft als Geste bei wichtigen Ereignissen verschenkt, können letzte Grüsse sein und verweisen auf die Vergänglichkeit allen Lebendigens. Wachs vereint in sich Motivkomplexe des Fragments, der Anatomie und der Veränderung und ist durch seine unterschiedlichen Nutzungen und magisch-religiösen Verwendungen voller Konnotationen und symbolischer Bezüge. Die Videoarbeiten referenzieren zudem Vanitas-Motive in der «Nature Morte» und führen sie gleichzeitig ad absurdum. Die Inszenierung der Blumen verweisen darüber hinaus auf das im Barock aufkommende wissenschaftliche Blumenbild, welches zwischen naturwissenschaftlicher Darstellung und bildender Kunst oszilliert. Die Werkreihe entstand im Zusammenhang mit dem SNF-Forschungsprojekt «Sterbesettings – eine interdisziplinäre Perspektive».
Franziska Nyffenegger
Rose Rose Reseda: Ein Poesiealbum für Blumenfreund:innen
«Rose is a rose is a rose is a rose» schreibt die Dichterin Gertrude Stein, während der Designer Bruno Munari entgegenhält, die Rose sei ein ganz und gar nutzloses Objekt: kurzlebig, kostspielig und noch dazu kompliziert in der Benutzung.
Design und Poesie sind selten eng befreundet. Die Designerin denkt streng, sachlich und systematisch, der Poet hingegen widersetzt sich dem funktionalen Zeichentausch. Die Regeln der Pragmatik interessieren ihn nicht, Blumen hingegen schon. Seit der Antike sind sie Gegenstand der Dichtung, werden einzeln oder im Gebinde besungen, stehen für Freundschaft und Liebe, für Treue und Vergänglichkeit, Trost und Hoffnung. Anemone, Aster, Malve, Massliebchen, Veilchen und Vergissmeinnicht: Alles, was blüht, lässt sich poetisch gestalten.
Der Beitrag denkt zunächst darüber nach, was Design und Designtheorie allenfalls von der Poesie lernen könnten, und blättert dann, gemeinsam mit den Anwesenden, in einem eigens für diesen Anlass zusammengestellten Poesiealbum.
Erika Fankhauser Schürch
Gibt es die eine einzige perfekte Blumenvase?
Nein natürlich nicht, sowenig wie es die eine, einzige, perfekte Blume gibt. Die Frage nach idealen, formschönen Blumenvasen begleitet mich seit meiner Ausbildung zur Keramikerin vor gut 25 Jahren. Eigentlich noch viel länger. Bereits als Mädchen habe ich liebend gerne den Schrank mit Mutters Vasen durchstöbert. Als Jugendliche arrangierte ich Blumen aus unserem Bauerngarten, durfte Bindekurse besuchen, beschäftigte mich mit Ikebana. Ein längeres Praktikum bei einem bekannten Stadtberner Floristen zeigte mir die verschiedenen Seiten des Berufs. Der Antwort auf meine Frage kam ich dabei nicht näher, im Gegenteil.
An der Blumen-Tagung erzähle ich von meinen Vasen. Wie ich sie entwickle und teste, wie ich Prototypen forme, danach eine Gipsform herstelle, um die Vase in Serie zu produzieren. Vor allem aber erzähle ich über und mit frischen Blumen. Ich zeige auf, wie Blumen in verschiedenen Vasen wirken und sich entfalten können. Je nach gewünschter Stimmung, nach Standort, nach Umgebung „funktionieren“ ganz viele verschiedene Gefässe für ein und dieselbe Blume. Umgekehrt „funktionieren“ ganz viele verschiedene Blumen in ein und demselben Gefäss.
Ulrike Meyer Stump
Von grossen und kleinen Blumen bei Karl Blossfeldt (1865-1932)
«Wir Betrachtenden aber wandeln unter diesen Riesenpflanzen wie Liliputaner,» schreibt Walter Benjamin in seiner begeisterten Rezension von Karl Blossfeldts Pflanzenbildern, die 1928 im mittlerweile legendären Fotobuch Urformen der Kunst erschienen waren. Kurz vor Blossfeldts Emeritierung an der Berliner Kunstgewerbeschule, wo die Aufnahmen als Lehrmittel für seinen Unterricht in «Modellieren nach lebenden Pflanzen» entstanden waren, avancierte der Bildhauer dank seiner Publikation zu einem der bedeutendsten Fotografen der Moderne. Diesen Bedeutungswandel in der Rezeption seines Werks begleitete eine lebendige Diskussion über Grössenordnungen, wobei einerseits der Blick in kleinste Mikrowelten faszinierte, wie der Kunsthistoriker Max Deri erstaunt festhielt: „So also sieht die Welt im ‚Dichtesten‘ aus, in ihrem Kleingefüge, und inmitten derartiger Märchen leben wir, lebten wir schon immer, ohne es bisher zu wissen!“ Andererseits erfuhren Rezensenten wie Benjamin die monumentale Abbildung kleinster Pflanzendetails nicht nur einfach als Vergrösserung im technischen Sinne, sondern vielmehr als „das Erlebnis einer Sensation.“ Dieser Beitrag betrachtet Blossfeldts berühmte Pflanzen- und Blumenbilder und deren Rezeption unter dem Gesichtspunkt der Massstäblichkeit – als ein Eintauchen in eine vegetabile Welt, in der die Grössenordnungen tüchtig durcheinandergeraten sind – und fragt nach den Folgen für unser Verhältnis zur Natur.
David Jäggi
Von Tankstellenshop bis Grandhotel – eine fotografische Spurensuche
Eklektische Blumeninstallationen, Fairtrade-Wildwiesensträusse oder leuchtgelbe Mimosastauden: Drapiert in ausgesuchten Keramikvasen entfaltet sich aktuell ein neuer Sinn für florale Gestaltung – in Altbauwohnungen des urbanen Bürgertums, angesagten Popup-Restaurants oder zur Eröffnung des Flagshipstores. Ist dies Ausdruck einer neuen Lust auf Ornament und Opulenz? Ein Zeichen ungestillter Sehnsucht nach Naturbildern? Oder ein Symptom für fatalen Eskapismus in Krisenzeiten? Fragen, die sich aus der Perspektive der Trendforschung stellen lassen. Doch wie sieht es in der Empirie aus?
Ethnografisch ausgerüstet mit Kamera, Notizblock und einem Blick für Dekorationstechniken und Atmosphärenmanagement begebe ich mich auf eine Reise querfeldein. Vom Krankenhaus, über die Empfangshalle der Bank bis zum Zugrestaurant – Blumen agieren als stumme Requisiten zur räumlichen Aufwertung oder unterstützen soziale Gesten. Welche alltäglichen und zeitgenössischen Blumenästhetiken lassen sich in diesen Kontexten beobachten? Gibt es wiederkehrende Muster, Regeln oder Bedeutungen? Das Ergebnis dieser visuellen Recherche ist ein bunter Strauss alltagskultureller, ästhetischer Praktiken, der Fragen zu geschmacklicher Situiertheit, sozialer Verortung und Klasse aufwirft: Welche Blume gilt als bünzlig, welche Kombination ist Avantgarde und was wird als «gute» Gestaltung verstanden? In Form einer Diaschau werfe ich mit dieser Bildserie einen blitzlichtartigen, flüchtigen und vergänglichen Blick auf Blumen und Alltagskultur.
Informationen
Ort
Maison Shift
Zeughausstrasse 56,
8004 Zürich
Kasernenareal
1.Stock / Aufgang Metalltreppe, Wiese
Gestaltung
Dagna Salwa
Fotografien
Nura Sina Deon
Floral Design:
Natalija Počuča
Organisation
Anna-Brigitte Schlittler und Prof. Katharina Tietze, Trends & Identity, Zürcher Hochschule der Künste
www.trendsandidentity.zhdk.ch